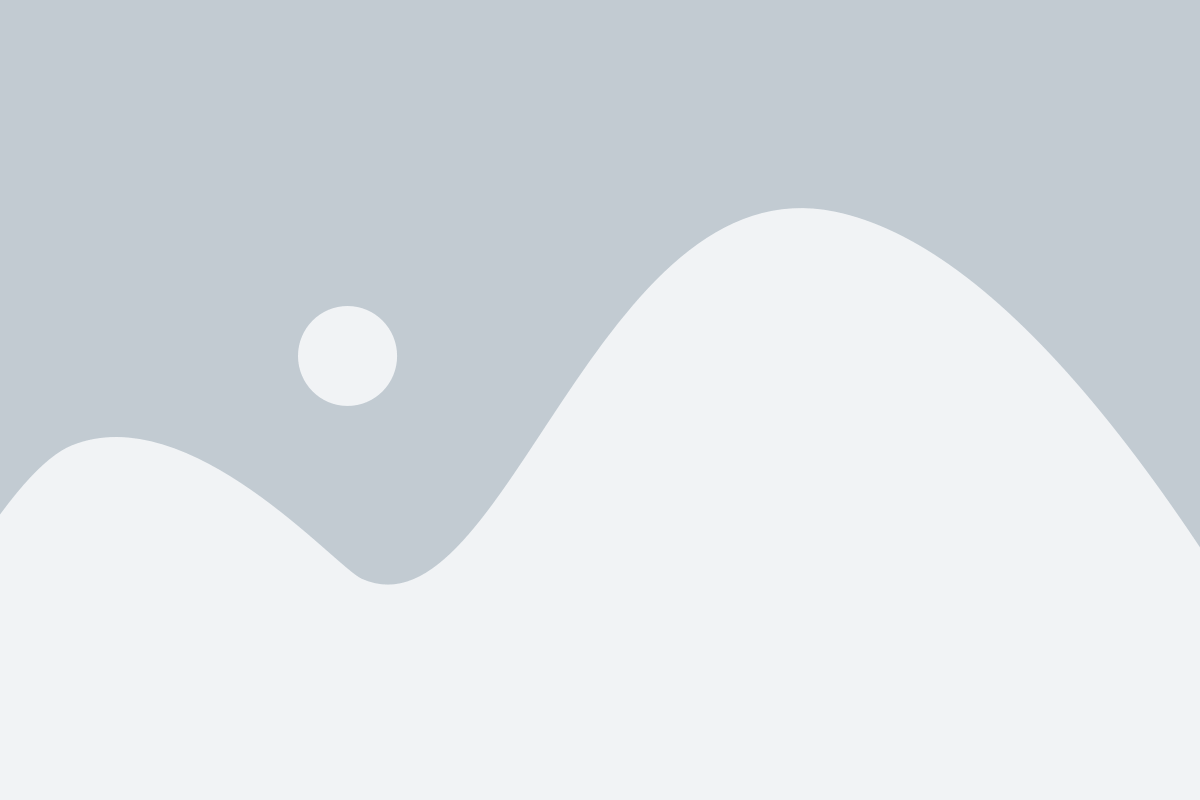Zuverlässigkeit messen: Fehler, Unsicherheiten, Vertrauen
Eine niedrige durchschnittliche Abweichung kann irreführen, wenn Spitzenzeiten schlecht getroffen werden. Ergänzende Metriken für Rampen, Peaks und Verteilungen zeigen, ob ein Modell dort gut ist, wo es wirklich zählt, nämlich in kritischen, wirtschaftlich relevanten Momenten.
Zuverlässigkeit messen: Fehler, Unsicherheiten, Vertrauen
Visualisierungen von Merkmalseinflüssen machen Entscheidungen greifbar. Wenn Betreiberinnen sehen, wie Bewölkungsgrad, Aerosole oder Temperatur die Prognose treiben, steigt Vertrauen. Das Team erkennt zudem, wo Datenqualität oder Modellannahmen gezielt verbessert werden sollten.